
Markets International 3/25 I Kambodscha I Wirtschaftsumfeld
Boom zwischen Textilfabriken und Onlinebetrug
Kambodscha gehört zu den wachstumsstärksten Ländern der Welt. Doch die Abhängigkeit von der Bekleidungsindustrie, von chinesischen Investitionen und von einer illegalen Schattenwirtschaft ist groß.
29.09.2025
Von Frank Malerius | Bangkok
Wer nach 20 Jahren wieder in Phnom Penh einfliegt, erkennt diesen Ort nicht wieder. Anstelle der ärmlichen Drittweltstadt steht hier nun eine brodelnde Metropole mit mehr Hochhäusern als in allen deutschen Großstädten zusammen. Am Ufer des Mekong ist eine bunte Amüsiermeile entstanden. Interessierte können Showrooms von Lamborghini, Bentley, Aston Martin, McLaren und BMW besuchen.
Der Eindruck des Reisenden korrespondiert mit den Wirtschaftszahlen: Laut Internationalem Währungsfonds (IWF) gehört Kambodscha seit dem Jahr 2000 zu den zehn wachstumsstärksten Volkswirtschaften weltweit. Wie hat das rohstoffarme Kambodscha, dessen gebildete Schichten vor 50 Jahren von den Roten Khmer ausradiert wurden, das geschafft?
Markets International Ausgabe 3/25
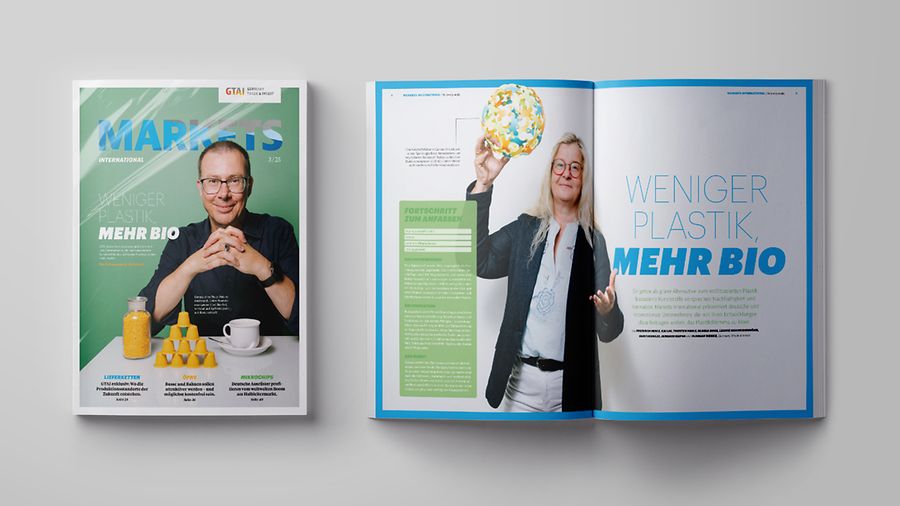
Zur Markets International 3/25
Zwischen Akkordarbeit und Korruption
Grundlage der Entwicklung ist die Bekleidungsindustrie. Fast eine Million Kambodschaner nähen im Akkord Hosen, T-Shirts und Blusen für den Weltmarkt. Textilprodukte machen die Hälfte der Exporte aus. Adidas lässt einen erheblichen Teil seiner Ware hier fertigen und bietet so zehntausenden Kambodschanern ein Auskommen. Allerdings nicht in eigenen Fabriken. Im ganzen Land gibt es keine deutsche und nur vereinzelt europäische Produktion. Für ein Engagement ist die Rechtssicherheit zu gering: Im Korruptionsindex von Transparency International rangiert Kambodscha auf Rang 158 von 180 Ländern. Die Politik wird seit 40 Jahren von der Familie Hun beherrscht.

Immerhin finden deutsche Produkte ihren Weg hierher: In den Supermarktregalen liegen Würstchen, Snacks und Kondome mit schwarz-rot-goldener Flagge auf der Verpackung. Ein Craft-Beer-Boom hat deutsche Brautechnik ins Land gebracht. Der bayerische Anlagenbauer Krones AG liefert Abfüllsysteme. „Kambodscha ist zwar ein kleiner Markt“, sagt auch Dim Sydeat, General Manager von Melchers Cambodia Co., „aber deutsche Maschinen haben einen exzellenten Ruf.“ Das Handelshaus, das in Bremen beheimatet ist, beliefert das Land unter anderem mit industriellen Markiersystemen für Nahrungsmittelverpackungen.
Kambodschas Aufstieg steht in Verbindung mit seinem Status als Least Developed Country (LDC): Die Exportwaren aus dem Land sind in der entwickelten Welt zollfrei. Das hat vor allem chinesische Unternehmen ins Land gelockt, die so US- und EU-Zölle auf Produkte aus China umgehen wollen. Ob das Konzept auch noch in Zukunft funktioniert, hängt stark von der US-Zollpolitik ab. Doch seitdem erwirtschaftet Kambodscha mit beiden Handelspartnern riesige Handelsüberschüsse. Die meisten Bekleidungsfabriken sind in chinesischer Hand. Ebenso die Elektronikfabriken.
Allerdings bleibt oft nur ein kleiner Anteil der Wertschöpfung im Land: Garne und Textilmaschinen kommen aus China, ebenso elektronische Vorprodukte. Und mancherorts, so der Verdacht, wird das Zollumgehungsgeschäftsmodell zum Zollumgehungsbetrug. Wenn etwa eingeführte Fertiggüter zu made in Cambodia umetikettiert werden.
Onlinebetrug im industriellen Maßstab
Jenseits der Fabriken gibt es in Kambodscha eine exorbitante, staatlich tolerierte Schattenwirtschaft. Sie dürfte die Nachfrage nach teuren Sportwagen begünstigen. Die Akteure führen Casinos, die entlang der thailändischen und vietnamesischen Grenze und in der Spielerstadt Sihanoukville Zocker aus den Nachbarländern und aus China im Visier haben. Sie betreiben Onlineglücksspiele, die in den Zielländern der Region verboten sind. Und sie unterhalten Scam-Center, in denen ausländische Zwangsarbeiter Landsleute in ihren Heimatländern betrügen. Ein US-Report vom Mai 2025 geht von 150.000 Mitarbeitern aus, die jährlich 19 Milliarden US-Dollar ergaunern. Das wäre mehr als ein Drittel der offiziellen kambodschanischen Wirtschaftsleistung.
Die gigantische informelle Ökonomie wirkt auf die Realwirtschaft: Seit China Kambodscha verordnet hat, das Onlineglücksspiel zu beschränken, ist die Bauwirtschaft eingebrochen. Der IWF erwartet für die kommenden Jahre Wachstumsraten von teils unter vier Prozent. Zusätzliche Sorge bereitet der Verlust des LDC-Status ab 2029, auf Waren aus Kambodscha fallen dann Zölle an.
Pioniere gesucht

Tassilo Brinzer ist Gründer und stellvertretender Vorsitzender von Euro Cham Cambodia, Vorsitzender von German Business Cambodia sowie stellvertretender Vorsitzender des EU-ASEAN Business Council.
Herr Brinzer, Sie leben seit 20 Jahren in Kambodscha. Wie hat sich das Land in dieser Zeit verändert?
Es ist von einem Entwicklungsland auf dem Weg zum Schwellenland. Die Armut nimmt ab, die Mittelschicht wächst. Immer mehr Menschen können sich Importwaren leisten.
Wie bewertet Kambodscha die neuen Importzölle der USA, die ja wichtigster Exportmarkt sind, von 19 Prozent?
Es herrscht Erleichterung. Denn die vorher angedrohten Zölle von erst 49, dann 36 Prozent hätten die Produktion getroffen. Allerdings ist Kambodscha jetzt für fast alle US-Produkte zollfrei. Wir rechnen aber nur mit einer leichten Verschiebung des Importmarkts zugunsten der USA. Für deutsche Lieferanten, die im Land jährlich nur Produkte im unteren dreistelligen Millionenwert verkaufen, hat das keine größeren Auswirkungen.
Warum produziert bisher kein deutsches Unternehmen in Kambodscha?
Für ein größeres Engagement ist vielen die Rechtssicherheit zu gering, der Compliance-Aufwand ist zu hoch. Zudem ist es schwierig, qualifiziertes Personal zu finden, vor allem in technischen Berufsfeldern. Und: Die Produktivität ist im Vergleich zu etablierten Märkten wie Vietnam oder Thailand niedrig.
Wie könnte es dennoch gelingen, deutsche Unternehmen nach Kambodscha zu bringen?
Es gibt erfolgreiche grenznahe Sonderwirtschaftszonen zu Thailand und Vietnam. Wem dort die Löhne zu hoch werden, könnte hier durchaus die passende Infrastruktur für eine industrielle Produktion vorfinden, die sich in regionale Lieferketten einfügen lässt.

