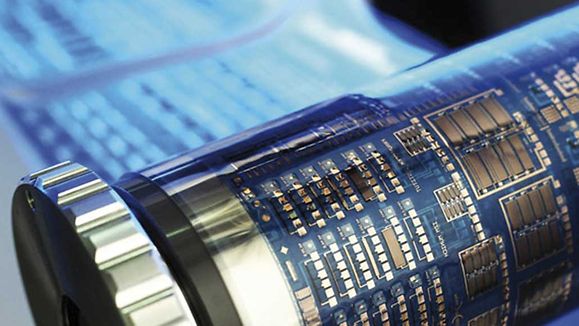Interview | EU | Halbleiterindustrie
Interview: "Europa sollte größtmögliche Produktionskapazität bewahren"
Noch ist Europas Chipbranche global wettbewerbsfähig. Doch um Anschluss zu halten, sind massive Investitionen und bessere Rahmenbedingungen nötig, sagt ZVEI-Experte Sven Baumann.
07.05.2025
Von Fabian Möpert, Gerit Schulze | Berlin

Der Verband der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI) engagiert sich stark für die Förderung der Halbleiterindustrie in Europa. Im Interview mit Germany Trade & Invest erklärt Sven Baumann, Senior-Referent für Mikroelektronik und Sensorik beim ZVEI, wie die EU ihre Marktposition stärken kann.
Wie schätzen Sie die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Halbleiterbranche ein?
Aktuell besteht eine gegenseitige Abhängigkeit der sechs Halbleiter produzierenden Regionen USA, Europa, Taiwan, Südkorea, Japan und China. Keine dieser Regionen verfügt über Autarkie und wäre fähig, die eigenen Chip verarbeitenden Industrieunternehmen mit allen benötigten Halbleitern zu beliefern.
Von daher spielen Deutschland und die EU immer noch eine große Rolle. Wir gehören vor allem bei Mikrocontrollern, Leistungshalbleitern und Sensoren zur Weltspitze. Allerdings muss Europa vom Design bis zum Packaging stark investieren, um weiterhin zur Führungsspitze zu gehören. Auch die Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel Energiekosten und Fachkräfteverfügbarkeit, sollten verbessert werden.
"Ohne Halbleiter sind Schlüsseltechnologien undenkbar."
Muss auch Europas Elektronikbranche animiert werden, mehr Halbleiterprodukte nachzufragen?
Eine starke Mikroelektronikindustrie bedarf einer starken Nachfrage aus den Anwendungsindustrien. Die europäischen Schlüsselindustrien wie Automobil und Maschinenbau sowie heute unterrepräsentierte Sektoren wie KI-Anwendungen und Rechenzentren müssen gezielt gestärkt werden, um Innovationen und Synergien entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu fördern.
Die Elektronikindustrie wird Halbleiterprodukte in einer Größenordnung nachfragen, die sie für die Herstellung ihrer Produkte benötigt. Die Mikroelektronik bildet heute die technologische Grundlage für viele Megatrends wie Digitalisierung, Elektrifizierung und Automatisierung sowie den Einsatz von KI. Schlüsseltechnologien wie erneuerbare Energien, Elektroautos oder smarte Industrieanwendungen sind ohne Halbleiter undenkbar.
Ist das Ziel realistisch, Europas Marktanteil an der globalen Chipproduktion bis 2030 auf 20 Prozent zu verdoppeln?
Nein, das ist es nicht. Nur bei einer Verstetigung der aktuellen Fördermaßnahmen könnte Europa seinen globalen Anteil an den Fertigungskapazitäten nahezu konstant halten. Ohne zusätzliche Maßnahmen und basierend auf den derzeit geplanten Förderprojekten könnte der Anteil auf unter 6 Prozent sinken. Das zeigt, welchen entscheidenden Beitrag staatliche Förderungen in einem kapitalintensiven und strategisch wichtigen Bereich wie der Mikroelektronik für die Wettbewerbsfähigkeit dieser Industrie leisten.
Was muss neben der öffentlichen Förderung noch getan werden, um dieses Ziel zu erreichen?
Europa sollte unbedingt eine größtmögliche Produktionskapazität bewahren oder sogar ausbauen. Darauf haben verschiedene Rahmenbedingungen Einfluss: Genehmigungsverfahren und Bürokratie, Energiekosten, Fachkräfte, Infrastruktur und Subventionen.
Ein Beispiel sind die geplanten Regulierungen für sogenannte Forever Chemicals, also langlebige Chemikalien. Sie werden in der Halbleiterproduktion in Schlüsselprozessen wie der Lithografie oder beim Ätzen eingesetzt und sind aufgrund ihrer chemischen Stabilität bisher kaum zu ersetzen. Ein einseitiges Verbot durch die EU könnte die Verfügbarkeit dieser Stoffe einschränken, zu erheblichen Kostensteigerungen führen und die Produktionskapazitäten europäischer Halbleiterhersteller gefährden.
"Energienetze erweitern und Speicherkapazitäten vorantreiben."
Ebenso wichtig ist die Energieversorgung. Moderne Halbleiterfabriken verbrauchen jährlich so viel Strom wie 150.000 Haushalte. Selbst moderate Preisanstiege beeinträchtigen die Wettbewerbsfähigkeit der in Europa produzierenden Halbleiterunternehmen. Darüber hinaus können Netzinstabilitäten zu Produktionsausfällen und somit zu hohen wirtschaftlichen Schäden führen. Es ist notwendig, die europäischen Energienetze zu erweitern und den Ausbau von Energiespeicherkapazitäten voranzutreiben.
Sind die strengen Umweltvorschriften in Europa ein Wettbewerbsnachteil?
Europa könnte durch die Kombination hoher Umweltstandards, einer starken Infrastruktur und technologischen Innovationen ein globaler Vorreiter in der nachhaltigen Halbleiterproduktion werden. Prinzipien der Kreislaufwirtschaft reduzieren die Abhängigkeit von kritischen Rohstoffen wie Gallium, Germanium und Tantal. Diese Rohstoffe sind essenziell für die Chipproduktion.
Was sind Europas Stärken auf dem Gebiet der Halbleiterindustrie?
Bei Maschinen und Werkzeugen für die Halbleiterproduktion hat die EU einen Weltmarktanteil von fast 40 Prozent. Es braucht viel technologisches Know-how und ein spezialisiertes Lieferantennetzwerk, um solche fortschrittlichen Maschinen zu entwickeln. Zum Beispiel ist ohne modernste Lithografiemaschinen die Produktion der kleinsten Strukturbreiten für High-Performance Computing und KI-Chips nicht möglich. In diesem Bereich stellt die EU einen globalen Marktführer. Diese Position könnte jedoch unter Druck geraten, da chinesische Unternehmen aufgrund von Exportverboten gezwungen sind, eigene Lösungen zu entwickeln.
Gut aufgestellt ist Europa zudem bei Produktionsmaterialien sowie Prozesschemikalien und -gasen. Bei Silizium-Wafern dominieren zwar japanische Unternehmen. Dennoch spielt die EU ebenfalls eine bedeutende Rolle.
Beim Chipdesign liegen US-amerikanische Unternehmen bei KI und High-Performance Computing vorn. Doch die EU hat ihre Stärken bei Energiemanagement, Sensorik und Mikroprozessortechnologien.
In Kontext von KI und High-Performance-Computing gewinnen Open-Source-Modelle beim Chipdesign immer mehr an Bedeutung. Mehrere europäische Unternehmen haben Quintauris gegründet, das Technologien entwickelt, die auf der lizenzfreien Hardwarearchitektur RISC-V-basieren.