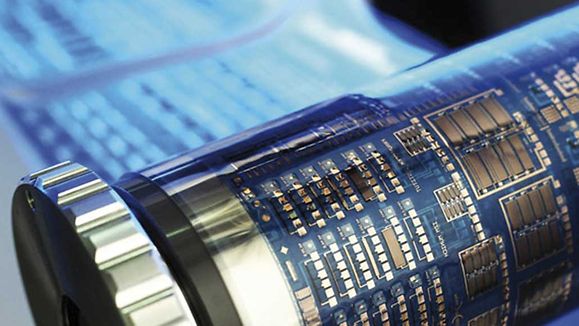Die Mikroelektronik ist ein extrem forschungsintensives Geschäftsfeld. Um die Technologie zu beherrschen, müssen die EU-Länder die Ausbildung von Spezialisten vorantreiben.
In der Halbleiterindustrie finden Innovationen in kurzen Abständen und großen Schritten statt. Umso wichtiger ist es, dass Europa die nötigen Kapazitäten für Forschung und Entwicklung bereithält und entsprechenden Fachkräftenachwuchs ausbildet. Der European Chips Act sieht vor, die Ausbildung der Fachkräfte zu harmonisieren und einen Talentpool zu schaffen. Geplant ist, mehr internationale Talente anzuwerben und bürokratische Hindernisse zu reduzieren. Die Ausbildung muss praxisorientierter werden, damit junge Menschen sich für die Branche interessieren.
Denn der Personalmangel gilt als große Herausforderung für die europäische Halbleiterindustrie. Die derzeit geplanten neuen Chipfabriken brauchen bis zu 15.000 zusätzliche Fachkräfte. Bis 2030 erwartet die European Semiconductor Industry Association (ESIA) eine Bedarfslücke von 75.000 Beschäftigten. Das Thema adressierte im September 2024 auch der Bericht zur Wettbewerbsfähigkeit Europas von Mario Draghi. Der ehemalige Präsident der Europäischen Zentralbank schlägt vereinfachte Visaverfahren für Nicht-EU-Bürger und neue Stipendienmöglichkeiten vor. Die ESIA regt an, die Sichtbarkeit der Halbleiterindustrie unter Schülern in Gymnasien zu erhöhen, um mehr Studierende für naturwissenschaftliche Fächer zu begeistern.
Institute von Weltrang sitzen in Europa
Beim Forschungsumfeld für die Halbleiterbranche ist Europa durchaus wettbewerbsfähig. Bereits heute haben in der EU einige der weltweit führenden Forschungseinrichtungen und große Chiphersteller ihren Sitz, die Technologiesprünge vorantreiben. Dazu gehören in Deutschland die Fraunhofer-Institute, im belgischen Leuven das IMEC, in Frankreich das CEA-Leti in Grenoble sowie das III-V Lab des Forschungsclusters Paris-Saclay. Das CEA-Leti zum Beispiel hat die FD-SOI-Technologie (Fully Depleted Silicon-On-Insulator) erfunden, bei der ultradünne Schichten verwendet werden.
Solche Institute bekommen künftig mehr finanzielle Unterstützung über den European Chips Act. Ziel ist es, auf dem ganzen Kontinent ein Netzwerk von Kompetenzzentren für die Halbleiterindustrie zu schaffen. In einer ersten Förderrunde wurden 2024 Einrichtungen in 24 EU-Mitgliedstaaten und in Norwegen ausgewählt. Sie bekommen aus Brüssel aus nationalen Haushalten eine Kofinanzierung von über 170 Millionen Euro.
Brutstätten für Innovation
Laut EU-Kommission sollen in allen 27 EU-Ländern sowie in Norwegen und Island Kompetenzzentren für die Halbleiterindustrie entstehen. Ende 2024 endete der erste Förderaufruf. Eine zweite Ausschreibung folgt 2025. Die Zentren unterstützen die europäischen Halbleiterunternehmen mit wichtigen Ressourcen und werden sich auf bestimmte Schlüsseltechnologien spezialisieren.
Finnland forscht an Chipdesign und Verpackung
Eines der geplanten Kompetenzzentren entsteht in Finnland. Standort für das Finnish Chips Competence Center (FiCCC) ist Tampere, 180 Kilometer nordwestlich von Helsinki. Dort wird vor allem an Chipdesign und Packaging geforscht. Die örtliche Universität bekommt 40 Millionen Euro Fördermittel zum Aufbau einer Pilotlinie für Halbleiter mit breitem Bandabstand (WBG).
Ein weiterer Forschungsfokus liegt auf der Hauptstadtregion. Im Großraum Helsinki haben über 40 Unternehmen ihren Sitz, zum Teil mit eigenen Entwicklungszentren. Führend sind die Aalto Universität, die Universität Helsinki und das Technische Forschungsinstitut von Finnland VTT.
"In Finnland funktioniert der Austausch zwischen Forschung und Industrie sehr gut", sagt Sanna Vesti, Senior Account Manager bei Infineon in Espoo. "Aus den Glanzzeiten von Nokia ist auf dem Gebiet der Halbleitertechnologie noch viel Know-how vorhanden, das genutzt werden kann."
Tschechien hofft ebenfalls auf ein Chips-Kompetenzzentrum. Federführend sollen dabei der Chipdesigner Codasip aus Brno sein sowie das Hochleistungsrechenzentrum IT4Innovations in Ostrava. Die Forschung soll sich auf Prozessorkerne mit RISC-V-Technologie konzentrieren.
Mit der Technischen Universität Brno und vier Industriepartnern nimmt Tschechien am Bildungsprogramm "Chips of Europe" teil. Neue Halbleiterstudiengänge werden an den Universitäten in Plzeň, Zlín und Ostrava eingeführt. Hochschulen in Brno und Prag kooperieren mit taiwanesischen Instituten. "Wir tun also unser Bestes, um die Tschechische Republik auf die Herausforderungen für qualifizierte Fachkräfte vorzubereiten", sagt Michal Lorenc vom Czech National Semiconductor Cluster im Interview mit Germany Trade & Invest.
Aus Süditalien wandern die Talente ab
In Italien konzentriert sich die Forschung auf Halbleiter für die Kfz-Industrie. Die werden unter anderem am Institut IMM (Istituto per la Microelettronica e Microsistemi) in Catania entwickelt. An dem Projekt sind die Fraunhofer-Gesellschaft, das Mikroelektronikzentrum IMEC aus dem belgischen Leuven und CEA-Leti aus Frankreich beteiligt.
Ein weiterer Forschungsschwerpunkt sind integrierte Schaltkreise. Hiermit beschäftigt sich seit 2024 die Fondazione Chips.IT in Pavia bei Mailand zusammen mit STMicroelectronics, Infineon und weiteren Unternehmen.
An Chips für künstliche Intelligenz und High-Performance Computing Chips (HPC) wird in Bologna geforscht. Dort eröffnete der französische Investor SiPearl 2024 ein Entwicklungszentrum.
In Nord- und Mittelitalien gibt es einen ausgeprägten Fachkräftemangel. Aus dem Süden wandern dagegen Talente ab, auch wegen der niedrigen Gehälter: IT-Spezialisten in Catania verdienten 2024 im Schnitt 25 Prozent weniger als in Mailand.
Die Niederlande versuchen, dem Fachkräftemangel mit einem attraktiven Umfeld zu begegnen. Das Land investiert 2,5 Milliarden Euro in Bildung, moderne Büroarbeitsplätze, in Nahverkehr und bezahlbaren Wohnraum für IT-Spezialisten.
Österreich profitiert von hoher Lebensqualität
In Österreich konzentriert sich das Silicon Alps Cluster mit großen Forschungseinrichtungen und vielen Start-ups in Kärnten und der Steiermark. Bedeutung für die Entwicklung produktreifer Ideen hat das Silicon Austria Labs (SAL) in Graz, Linz und Villach. In Villach betreibt SAL den größten Forschungsreinraum Österreichs.
Ein weiterer Hotspot ist der Lakeside Science & Technology Park in Klagenfurt. Dort arbeiten Universitätsinstitute und Unternehmen der Informations- und Kommunikationsbranche Hand in Hand. Auch die deutschen Akteure Infineon und Fraunhofer sind beteiligt.
Die Fachkräftesituation im Süden Österreichs ist nicht einfach, unter anderem wegen der alternden Bevölkerung. Infineon kann als bekanntes Unternehmen Arbeitskräfte aus dem Ausland anwerben. Kleinere Unternehmen stoßen oft auf Schwierigkeiten bei der Rekrutierung.
Die Chip-Strategie in Polen sieht ebenfalls eine Stärkung der Forschungslandschaft vor. Das Łukasiewicz-Institut für Mikroelektronik und Fotonik (IMiF) und das Institut für Hochdruckphysik der Polnischen Akademie der Wissenschaften (IWC PAN) arbeiten gemeinsam an Halbleitern mit breitem Bandabstand (WBG), die höhere Spannungen und Temperaturen vertragen. Im Mittelpunkt steht der Einsatz von Galliumnitrid (GaN). Das Zentrum CEZAMAT der Technischen Universität Warschau ist an der Entwicklung der Halbleitertechnologie FD-SOI beteiligt.
Polen nutzt außerdem Gelder aus dem europäischen Wiederaufbaufonds, um neue Forschungskapazitäten aufzubauen. Das IMiF investiert gemeinsam mit dem Łukasiewicz-Institut für Tele- und Radiotechnik (ITiR) und CEZAMAT in neue Forschungsräume für Arbeiten an GaN-Bauelementen, Infrarot-Photonik und integrierten Schaltkreisen.
Bukarest als Talentschmiede auch für deutsche Firmen
Zur wichtigen Talentschmiede der europäischen Chipindustrie will Rumänien werden. Das Forschungsinstitut für Mikroelektronik IMT in Bukarest startete 2025 eine nationale Technologieplattform. Dort werden Fachkräfte im Bereich Materialforschung ausgebildet. Deutsche Konzerne wie Bosch oder Continental nutzen das rumänische Know-how, um Chiplets zu entwickeln und Schaltkreise zu programmieren.
Eines der führenden Forschungsunternehmen im Land ist MGM Star Construct, das Entwicklungsdienstleistungen für große europäische Hersteller anbietet. Es verfügt über mehrere Diffusionsöfen, um Silizium mit leitfähigen Metallkombinationen zu verbinden.
Ebenfalls stark in der Erforschung neuer Materialien für die Chipindustrie ist Spanien. Das Land hat sich international gut vernetzt. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Entwicklung photonischer Halbleiter, die deutlich weniger Energie verbrauchen. So arbeiten im Rahmen der Initiative PIXEurope fünf spanische Forschungsinstitute und Universitäten mit europäischen Partnern an diesem Thema. Für den Aufbau einer Pilotlinie für photonische Chips hat das Konsortium den Standort Valencia ausgewählt.