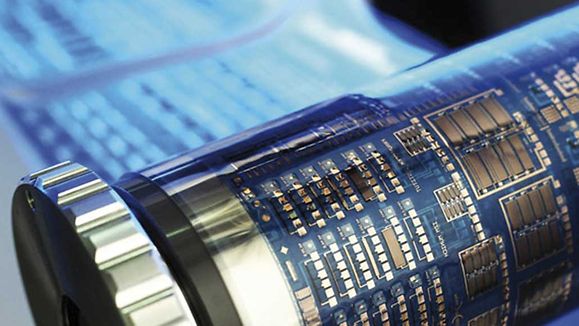Interview | EU | Halbleiterindustrie
Interview: "Spitzenforschung geht nur mit einer Fabrik in der Nähe"
Der Großraum Dresden ist ein Zentrum der europäischen Chipindustrie. Ein Interview mit dem Geschäftsführer des Silicon Saxony über die anstehenden Herausforderungen der Branche.
07.05.2025
Von Fabian Möpert, Gerit Schulze | Berlin, Prag

Frank Bösenberg ist Geschäftsführer von Silicon Saxony, dem größten Mikroelektronik-Cluster in Europa. Zu dem Netzwerk gehören rund 600 Mitglieder aus den Bereichen Mikroelektronik, Smart Systems und Software. Für 2025 hat der Dresdener außerdem den Vorsitz der Silicon Europe Alliance. Im Interview mit Germany Trade & Invest erzählt Frank Bösenberg über Dresdens Halbleiter-Erfolgsgeschichte, über europäische Kooperationen und über die Aussichten des Kontinents, zur Weltspitze aufzuschließen.
Die Region Dresden gilt als ein Zentrum der europäischen Halbleiterindustrie. Was ist das Erfolgsgeheimnis des Silicon Saxony?
Einer der wichtigen Faktoren ist die lange Geschichte des Clusters, die 1961 mit einer Forschungsstelle begann. Dresden war eines der Zentren der Mikroelektronikproduktion in der ehemaligen DDR. Nach dem Mauerfall blieb eine gut ausgebildete Personalbasis. Öffentliche Förderungen führten dazu, dass Siemens und AMD hier Werke bauten. Staatliche Investitionen in die Forschungslandschaft wie die Ansiedlung von Fraunhofer-Instituten trugen ebenfalls zur Entwicklung bei.
Heute gibt es in Dresden mindestens fünf große Player: Infineon, GlobalFoundries, X-Fab, Bosch und ESMC. Diese Unternehmen betreiben eigene Fabriken und haben eine komplexe Zulieferindustrie angezogen. Viele Zulieferer sind Ausgründungen des einstigen Staatskonzerns.
Wie wichtig ist es, dass die Zulieferer in unmittelbarer Nähe der Chipfabriken sind?
Viele Lieferanten sind global verteilt, aber ein gewisses Set an Zulieferern muss dicht an der Fabrik sein. Das Verhältnis von Arbeitsplätzen in den Chipfabriken zu Zulieferern im Umfeld von etwa 50 Kilometern beträgt eins zu drei.
"Überall sind die Investments höher als in Europa"
Die EU will in der globalen Liga der Halbleiterstandorte mitspielen. Wie schätzen Sie die Chancen dafür ein?
Die Investments in die Branche sind global überall höher als in Europa. Mir ist nicht klar, wie wir in einem insgesamt wachsenden Markt mit weniger Finanzmitteln besser als die anderen werden wollen. Deshalb halte ich eine Aufholjagd eigentlich für unmöglich. Es bräuchte einen Market Pull, eine stärkere Nachfrage nach Halbleiterprodukten. Doch die Schwäche der Endkundenbranche, also der Elektronikbranche in ganz Europa, führt dazu, dass es keine marktgetriebene Nachfrage für Investmentprojekte gibt.
Wäre es dann für Europa nicht besser, sich auf Halbleiterprodukte zu spezialisieren, bei denen wir aufgrund unserer Industrietradition stark sind und viele Anwender haben, zum Beispiel im Fahrzeugbau?
Europa versucht, seine Stärken zu stärken. Doch die höchsten Margen im Halbleitersektor werden mit KI-Chips erzielt, und da sind wir nicht dabei. In zwei Bereichen der Chipindustrie haben wir im Moment gar nichts mehr in Europa: bei Speichertechnologien und bei den kleinen Strukturgrößen. Ich finde, wir sollten in allen Feldern den technologischen Anschluss halten. Nicht umsonst gibt es den Spruch "The Fab is the lab". Das heißt, Spitzenforschung geht nur, wenn in der Nähe eine Produktionsfabrik ist. Der Digital Compass der EU sieht bewusst auch die Produktion von Halbleitern mit Strukturgrößen von 2 Nanometern vor. Doch das beherrschen nicht hunderte Akteure, sondern nur drei bis vier.
"Kleine EU-Länder können kaum große Investoren anziehen"
Was müsste auf EU-Ebene passieren, damit das Thema schneller vorankommt?
Die EU hatte schon 2013 versucht, einen "Airbus of Chips" auf den Weg zu bringen. Ziel war ein Weltmarktanteil von 20 Prozent bis 2020. Es gab 10 Milliarden Euro Förderung, die weitere 100 Milliarden Euro Investment hebeln sollten. Ein Ergebnis ist das Bosch-Werk in Dresden. Es ist also durchaus etwas passiert. Aber Europas Marktanteil ging nicht in Richtung 20 Prozent, sondern runter auf 9 Prozent. Jetzt erleben wir das Gleiche mit dem EU Chips Act. Wieder wird es in Europa als riesiges Projekt wahrgenommen, aber im globalen Maßstab ist es klein. Die Voraussetzungen sind dieses Mal sogar noch schlechter, weil die EU-Kommission die Investitionszuschüsse komplett auf die Mitgliedstaaten ausgelagert hat. Damit haben gerade kleinere Länder keine realistische Chance, einen großen Investor anzuziehen. Insofern ist das kein wirklich europäischer Ansatz.
Das klingt resignierend.
Mir fehlt eine echte Strategie. Wie und in welchen Segmenten wollen wir Strukturgrößen von 2 Nanometern erreichen oder 20 Prozent Marktanteil? Wie ein wirklicher Moonshot-Ansatz funktionieren könnte, zeigt uns Japan mit Rapidus [ein neu gegründeter Halbleiterhersteller, der bis 2027 einen 2-Nanometer-Prozess erreichen soll, Anm. d. Red.]. In Bezug auf den Finanzbedarf lässt dieses Projekt alles lächerlich aussehen, was wir in Europa machen. Dass das nicht mal in der Debatte auftaucht, finde ich bedauerlich.
Gibt es auch positive Aspekte am EU Chips Act?
Die Branche bekommt wieder neuen Schub und wird wachsen, insbesondere im Silicon Saxony. Aber wir können Europa nicht alleine retten. Das gesamte Wachstum, das Europa braucht, kann nicht im Silicon Saxony allein stattfinden. Wir bräuchten mindestens zehn weitere solcher Cluster, um Europa voranzubringen.
"EU Chips Act bringt neuen Schub"
Die europäischen Halbleiter-Cluster arbeiten über die Silicon Europe Alliance zusammen. Funktioniert diese Kooperation auch dann, wenn es darum geht, einen großen Investor wie TSMC oder Intel anzusiedeln?
Ein Grund für die Zusammenarbeit ist das Erzeugen von kritischer Masse. Die Marke Silicon Europe hat bei der EU-Kommission Türen geöffnet und wird innereuropäisch wahrgenommen. Außerdem stimmen wir uns bei europäischen Initiativen wie den European Digital Innovation Hubs ab. Andererseits ist die Marke gut für den Außenauftritt. Wir werben außerhalb Europas gemeinsam für Europa, zum Beispiel in Taiwan. In dem Moment, wo ein Investor Interesse zeigt, stehen die einzelnen Standorte natürlich in Konkurrenz zueinander. Aber im ersten Schritt wollen wir zeigen, dass Europa ein wichtiger Player ist. Das schaffen wir nur zusammen.
| Cluster / Land | Wichtige Unternehmen |
|---|---|
| Silicon Saxony / Deutschland | Infineon, Bosch, TSMC, GlobalFoundries |
| High Tech NL / Niederlande | ASML, Philips, NXP Semiconductors |
| Minalogic / Frankreich | STMicroelectronics, Soitec, Schneider Electric |
| Aktantis / Frankreich | STMicroelectronics, Thales, Schneider Electric |
| MESAP / Italien | Thales Alenia Space, Comau, Magneti Marelli |
| CNSC / Tschechien | Onsemi, NXP, Thermo Fisher |
| Midas / Irland | Intel, Onsemi, Analog Devices |
| OpenTech / Schweden | Ericsson, Sony, Telia |
| Silicon Alps / Österreich | Infineon, Intel, NXP, AT&S |
| TICE.PT / Portugal | Altice, OutSystems, Critical Software |
Dieser Inhalt gehört zu
- EU
- Europa, übergreifend
- Deutschland
- Frankreich
- Irland
- Italien
- Niederlande
- Österreich
- Polen
- Spanien
- Tschechische Republik
- Portugal
- Schweden
- Elektronik, übergreifend
- Photonik, Elektronische Bauelemente
- Unterhaltungselektronik, Fototechnik
- Signaltechnik
- Mess-, Regeltechnik
- Lieferketten, Beschaffung
- Digitale Wirtschaft
- Branchen